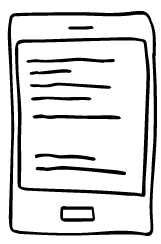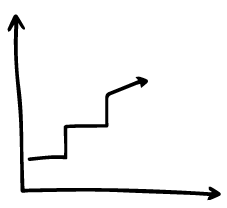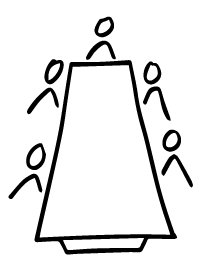Hilfeleistungen beginnen meist schon lange vor der Pflegebedürftigkeit und können vier Stunden täglich in Anspruch nehmen. Foto: pixabay
Das Wissen über Beschäftigte, die Angehörige pflegen, verdichtet sich in immer schnellerem Tempo. Die wichtigsten Aussagen des Themenreports, den das Zentrum für Pflege 2016 herausgegeben hat, haben wir bereits in unserem Journal „Beruf und Pflege – Trends und Empfehlungen“ im letzten Jahr zusammengefasst. In diesem Artikel haben wir weitere aufschlussreiche Studien der letzten beiden Jahre aufbereitet. Die zuletzt erschienenen Studien zeigen, dass die anerkannten Definitionen von Pflegebedürftigkeit für den betrieblichen Kontext, also für die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, viel zu eng gefasst sind. Darüber hinaus bestätigen sie, dass Zeitnot die größte Herausforderung bei Beruf und Pflege ist und staatliche Hilfeleistungen so selten in Anspruch genommen werden, weil sie am Bedarf vorbeigehen.
Pflegebedürftigkeit im betrieblichen Kontext muss neu definiert werden
Pflegebedürftigkeit wird beispielsweise durch die Pflegeversicherungen definiert und in verschiedene Stufen untergliedert. Für die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege greift diese Definition jedoch zu kurz. Aktuelle Studien weiten die Pflegebedürftigkeit, wie sie im Sinne der Pflegeversicherung definiert ist, auf die Phase der Hilfsbedürftigkeit aus, die in der Regel einer Pflegebedürftigkeit voraus geht. Denn der Großteil der pflegenden Erwerbstätigen kümmert sich um Angehörige, die zwar hilfe- aber noch nicht pflegebedürftig oder nur eingeschränkt pflegebedürftig sind. Je höher der Pflegeaufwand und je höher die Pflegestufe sind, desto seltener sind pflegende Angehörige erwerbstätig. Wollen Arbeitgeber*innen passgenaue Unterstützung leisten, muss diesem Fakt mehr Aufmerksamkeit als bislang gewidmet werden.
Begrifflichkeit erfasst nicht die einer Pflege vorausgehende Hilfsbedürftigkeit
Nach SGB XI, § 14, Abs. 1 sind Personen pflegebedürftig, „die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen können. Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, und mit mindestens der in § 15 festgelegten Schwere bestehen.“ [1] Die tatsächliche Pflege- und Hilfebedürftigkeit kann jedoch nicht mit diesem sozialrechtlich anerkannten Bedarf gleichgesetzt werden. Die Zahl der hilfebedürftigen Personen, die Pflege und Hilfe benötigen, auch wenn sie nicht die Kriterien des SGB erfüllen, ist deutlich höher als die Zahl der anerkannten Pflegebedürftigen. Einschlägige Studien gehen von vier bis fünf Millionen Personen aus.[2] Laut der Gesundheitsberichterstattung des Bundes waren im Jahr 2015 insgesamt 2,8 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland anerkannt. Das heisst, nur etwa die Hälfte der tatsächlichen Pflege- oder Hilfsfälle profitiert vom Pflegesystem.
Meist geht der Pflege der Hilfebedarf voraus
Zumeist beginnt eine Pflege schleichend, mit kleineren Unterstützungsleistungen beim Einkauf, im Haushalt und Garten, bei notwendigen Reparaturen, bei Arzt- und Behördengängen, und entwickelt sich erst allmählich zu einer umfassenden Pflege. Geholfen wird meist am Wochenende, am Abend oder unter Nutzung von Gleitzeit, mitunter auch unter Nutzung von Urlaubstagen.[3] Wie die Pflege wird die Hilfe in der Regel innerfamiliär geleistet. Sie gilt unter dem Gesichtspunkt der intragenerationellen Reziprozität als selbstverständlich.[4] Dabei sind diese Hilfestellungen in der Regel ähnlich zwingend erforderlich wie die Pflege. Es entstehen, wie eine Studie aus 2017 ergab, Aufwendungen in nennenswerten Umfang auch bei solchen Personen, die keine Pflegeeinstufung erhalten haben. In mehreren Haushalten, deren Antrag auf Pflegeleistungen abgelehnt wurde, fiel 2017 ein zeitlicher Unterstützungsaufwand von gut vier Stunden täglich an, vor allem im Bereich Hauswirtschaft und Betreuung.[5]
Beschäftigte vereinbaren vor allem Hilfeleistungen mit ihrer Erwerbstätigkeit
All diese Hilfeleistungen werden in der Regel bedarfsorientiert und zusätzlich zum aktuell bestehenden Erwerbsumfang geleistet, manchmal über Jahre. Einer Paneluntersuchung aus dem Jahr 2014 zufolge hält es der Großteil der pflegenden Angehörigen für wichtig bzw. sehr wichtig, auch mit Übernahme von Hilfe bzw. Pflege erwerbstätig zu bleiben.[6] Insofern ist es logisch, dass im betrieblichen Kontext die Vereinbarkeit der Erwerbstätigkeit mit regelmäßigen Hilfestellungen, leichter bis mittlerer Pflegebedürftigkeit sowie plötzlicher oder kurzfristiger schwerer Erkrankung dominiert. Kaum eine Person, die eine angehörige Person mit Pflegestufe II oder III pflegt, ist in der Lage, ihre Erwerbstätigkeit uneingeschränkt fortzuführen.
Anteil der Vollzeitbeschäftigung bei Pflegenden steigt
Die Vollzeitbeschäftigung unter Pflegeleistenden ist von knapp 31 Prozent im Jahr 2001 auf fast 38 Prozent im Jahr 2012 gestiegen. Sie liegt aber deutlich hinter dem Anteil der Vollzeitbeschäftigten an der gesamt erwerbsfähigen Bevölkerung in Höhe von 51 Prozent. Besonders groß war der Zuwachs der Vollzeitbeschäftigung bei jenen, die sich um Angehörige kümmern, die in ihren eigenen Haushalten leben. Bei ihnen ist die Vollzeitbeschäftigung bis 2012 von gut 29 auf über 40 Prozent angestiegen.[7]
Trotzdem bleibt Arbeitszeitreduzierung häufig gewähltes Entlastungsmittel
Hilfe und Pflege mit einer uneingeschränkten Berufstätigkeit in Einklang zu bringen, bleibt unabhängig von diesen Zahlen herausfordernd. Zur Vermeidung von Überlastung entscheidet sich ein nach wie vor großer Teil der pflegenden Beschäftigten für eine Reduzierung der Arbeitszeit oder einem vorzeitigen Ausstieg aus der Erwerbstätigkeit.[8] Von 30.000 pflegenden Personen, die nicht mehr erwerbstätig sind, haben fast 70 Prozent ihre Berufstätigkeit für die Übernahme der Pflege vorzeitig beendet.[9]
Schwere der Pflege entscheidet über Umfang der Arbeitszeitreduzierung
Der Umfang der Arbeitszeitreduzierung hängt von der Schwere der Pflegebedürftigkeit ab. Personen, die sich um eine Person in Pflegestufe II oder III kümmern, sind auffallend häufiger teilzeit- oder stundenweise erwerbstätig als Beschäftigte, die eine Person in Pflegestufe I oder Null unterstützen. Zudem reduzieren Angehörige, die ganz plötzlich mit einer Pflegeaufgabe konfrontiert wurden, die Arbeitszeit häufiger als Angehörige, die langsam in die neue Situation hineinwachsen konnten.[10]
Pflegende erwerbstätige Männer bleiben eher in Vollzeit als ihre Kolleginnen
Bereits 2015 erschien eine Studie, die sich ausschließlich mit erwerbstätigen pflegenden Männern beschäftigt. Zunächst einmal fand sie die weit verbreitete Vermutung nicht bestätigt, wonach Männer sich nur am Rande und überwiegend organisatorisch um die Belange ihrer Angehörigen kümmern. Von den 37 Männern, mit denen die Autor*innen Interviews führten, haben alle in erheblichem Maße Pflegeaufgaben übernommen. Häufig wurden aufeinanderfolgend oder parallel sogar beide Elternteile betreut. Gleichwohl haben fast alle interviewten Männer kontinuierlich in Vollzeit weitergearbeitet (in 30 von 37 Fällen). Entlastung suchten sie vor allem durch informelle Regelungen oder flexible Arbeitszeitmodelle. Außerdem griff die Mehrheit der erwerbstätigen männlichen Hauptpflegepersonen unterstützend auf (semi)professionelle Dienstleistungen zurück.[11]
Neun bis zwölf Stunden Hilfeleistung pro Woche bei Vollzeit, 19 bei Teilzeit
Dem DGB-Index Gute Arbeit von 2017 zufolge wenden pflegende Frauen in Vollzeit für die Betreuung von Angehörigen im Wochendurchschnitt neun Stunden auf, Männer 12 Stunden. Bei teilzeitbeschäftigten Frauen liegt der wöchentliche Zeitinvest bei 19 Stunden. Für Männer in Teilzeit ist auf Grund der geringen Fallzahl keine Aussage möglich. Im Durchschnitt wenden pflegende Beschäftigte 13,3 Stunden pro Woche für die Pflege auf.[12]
Jede zweite Hilfe oder Pflege erfolgt ohne informelle oder professionelle Unterstützung
Häusliche Hilfe und Pflege erfolgen meist durch eine Hauptpflegeperson, die das Pflegearrangement organisiert und maßgebliche Teile der Versorgung leistet.[13] Je jünger die Pflegenden sind, desto eher sind auch weitere Personen aus dem sozialen Umfeld an der Hilfe oder Pflege beteiligt. Auch nutzen pflegende Kinder und Schwiegerkinder häufiger informelle und professionelle Hilfe als dies pflegende Ehepartner*innen tun. Erwerbstätige pflegende Angehörige nehmen häufiger als nicht erwerbstätige pflegende Angehörige Pflegedienste und hauswirtschaftliche Unterstützung in Anspruch (55 Prozent vs. 37 Prozent). Dennoch verzichtet fast die Hälfte aller befragten pflegenden Erwerbstätigen gänzlich auf Pflegedienste und auf andere professionelle Unterstützungsangebote. Die Verantwortung, Organisation und Hilfeleistungen liegen zumeist hauptsächlich bei einer einzigen Person.
Mit der Pflege entstehen meist zusätzliche Mobilitätsanforderungen
Die meisten pflegenden Vollzeiterwerbstätigen (rund 80 Prozent) wohnen außerhalb des Haushalts des oder der Pflegebedürftigen. So kommen zu Arbeitszeit, Arbeitsweg und Pflegezeit zumTeil erhebliche Fahrtwege zum Wohnort der zu pflegenden Person als weitere regelmäßig zu bewältigende Zeitanforderung hinzu.[14]
Knapp ein Drittel der pflegenden Beschäftigten leidet oft bis sehr oft an Zeitnot
Zeitbedingte Vereinbarkeitsschwierigkeiten kommen einer DGB-Befragung von 2017 zufolge bei insgesamt 29 Prozent der pflegenden Beschäftigten häufig bis oft vor. Bei den in Vollzeit Arbeitenden liegt der Anteil unter den Frauen bei 38 Prozent, unter den Männern bei 28 Prozent. Rechnet man die vollzeitbeschäftigten Frauen hinzu, die „immer wieder“ Zeitprobleme bei der Vereinbarkeit haben, steigt der Prozentsatz auf 78 Prozent. Bei den teilzeitbeschäftigten Frauen fallen die Werte deutlich besser aus. Von ihnen haben rund 14 Prozent häufig Zeitkonflikte zu bewältigen.[15] Neben den realen Zeitkonflikten wirkt zudem auch das Gefühl belastend, rund um die Uhr verfügbar sein zu müssen. Viele der Pflegenden klagten in den Interviews der Studien über Zeitprobleme bei der Erwerbstätigkeit, Partnerschaft, Betreuung von Kindern und eigener Freizeit. Vor diesem Hintergrund wundert es kaum, dass 72 Prozent der im Pflegepanel erfassten Personen die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf als eher schlecht bzw. sehr schlecht beschreiben.[16]
Neben der Zeit investieren Pflegende zum Teil auch erhebliche finanzielle Mittel
Pflegende leisten nicht nur einen hohen zeitlichen Einsatz, sondern bringen auch erhebliche finanzielle Mittel auf, um diese häusliche Versorgung aufrecht zu erhalten. Der DGB-Index kommt auf monatlich rund 360 Euro. Eine weitere Studie errechnete, dass für erwerbstätige Pflegepersonen, die täglich eine Stunde pflegen und nicht im Haushalt der zu pflegenden Person leben, das Einkommen auf 77 Prozent des Durchschnitteinkommens sinkt.[17]
Signifikanter Zusammenhang zwischen Pflegegrad und sinkender Lebenszufriedenheit
Die Ergebnisse einer Panelschätzung dokumentierten, dass die Zufriedenheit von Pflegepersonen im Vergleich zu Personen, die keine Pflege leisten, signifikant geringer ausfällt. Außerdem sinkt die allgemeine Lebenszufriedenheit mit dem Pflegeumfang. Auch die Zufriedenheit mit der sozialen Sicherung ist niedriger.[18]
Hohe gesundheitliche und psychische Belastungsrisiken für (erwerbstätige) Pflegende
Die zeitlichen, finanziellen und mentalen Herausforderungen, die mit der Angehörigenhilfe oder -pflege notgedrungen verbunden sind, steigern das Risiko (erwerbstätiger) Pflegender, belastungsbedingte Stresssymptome zu entwickeln, die vielfach im psychosomatischen Bereich angesiedelt sind.[19] So leiden Pflegepersonen im Vergleich zu Personen ohne Pflegeverantwortung stärker unter depressiven Symptomen, Stress und verringertem Selbstvertrauen. Zusätzlich ist häufiger, aber in einem geringeren Ausmaß, auch ihre körperliche Gesundheit beeinträchtigt.
Noch große Zurückhaltung bei der Kommunikation einer übernommenen Pflege am Arbeitsplatz
Laut ZQP kommunizieren gut 2016 gut 60 Prozent der Beschäftigten die Pflegeverantwortung nicht, aus Sorge um den Arbeitsplatz.[20] Eine weitere Studie ergab, dass 43 Prozent der darin befragten Beschäftigten aus Angst vor beruflichen Nachteilen von der Familienpflegezeit absehen und 31 Prozent bereits bei der maximal 10-tägigen kurzfristigen Arbeitsfreistellung negative Konsequenzen im Arbeitsleben befürchten.[21]
Verhaltene Nutzung gesetzlicher Pflegeunterstützung
Die gesetzlichen respektive staatlichen Unterstützungsangebote zur Entlastung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege werden nach wie vor unterschiedlich und zum Teil nach wie vor verhalten genutzt. Wichtigste und am häufigsten genutzte Entlastungsmaßnahme sind die ambulanten Pflegedienste, die allerdings Pflegebedürftigkeit im Sinne der Pflegeversicherung voraussetzt. Eine Fallstudie ergab, dass 64 Prozent der 1000 befragten Pflegenden einen Pflegedienst nutzen. Die Tagespflege lag bei einem Nutzungsanteil von 15 Prozent. Die Verhinderungs- bzw. Kurzzeitpflege wurde nur bei 16 Prozent bzw. 20 Prozent der Fälle genutzt. Hauswirtschaftliche Hilfeleistungen werden dagegen häufiger in Anspruch genommen. So bestellen beispielsweise 35 Prozent „Essen auf Rädern“ zur Entlastung.[22]
Geringe Nutzung gesetzlicher Entlastungsangebote für pflegende Erwerbstätige
Der DGB-Index von 2017 belegt eine nach wie vor geringe Nutzung der gesetzlichen Familienpflegezeit. Nur sechs Prozent von denen, die pflegebedingt ihre Arbeitszeit reduzierten, taten dies im Rahmen der Familienpflegezeit. Und auch das Pflegeunterstützungsgeld hatte nur ein Prozent von 235 in Voll- bzw. Teilzeit erwerbstätigen befragten Hauptpflegepersonen in Anspruch genommen.[23] Erklärt wird die geringe Nutzung der verschiedenen Unterstützungsangebote mit fehlenden Informationen, schlechten Erfahrungen, der Ablehnung von Hilfsangeboten durch die zu Pflegenden sowie und in erster Linie mit der grundsätzlich mangelnden Passgenauigkeit der Unterstützungsleistungen. Des Weiteren verweisen Studien darauf, dass pflegende Angehörige ihre Ressourcen und Kompetenzen häufig überschätzen und die Inanspruchnahme entsprechender Angebote als nicht notwendig empfinden.[24]
Kaum neue Empfehlungen zur betrieblichen Unterstützungsmaßnahmen
Insgesamt wiederholen sich die Empfehlungen, wie Arbeitgeber*innen ihre Beschäftigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Hilfe oder Pflege entlasten können. Neben den Anregungen zur flexiblen Arbeitszeit- und Arbeitsortgestaltung, der themenbezogenen Sensibilisierung und Schulung der Führungskräfte, der Förderung einer Vertrauenskultur, dem Angebot anonymisierter, niederschwelliger Informations- und Beratungsangebote sind es vor allem gesundheitsfördernde und stressentlastende Angebote, die in den letzten beiden Jahren besonders in den Fokus gerückt sind.[25]
Literaturverzeichnis
Auth, Diana u.a. (2015): Wenn Mitarbeiter Angehörige pflegen: Betriebliche Wege zum Erfolg. Ergebnisse des Projekts „Männer zwischen Erwerbstätigkeit und Pflege“ (MÄNNEP), gefördert von der Hans-Böckler-Stiftung. Düsseldorf: Hans Böckler Stiftung.
Bestmann, Beate u.a. (2014): Pflegen: Belastung und sozialer Zusammenhalt. Eine Befragung zur Situation von pflegenden Angehörigen. https://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/699766/Datei/140122/Bestmann-Pflegen-Belastung-und-sozialer-Zusammenhalt-2014.pdf (Letzter Zugriff: 19.3.2018)
compass private pflegeberatung (2016): Belastung pflegender Angehöriger. Ergebnisse der Forsa-Befragung im Auftrag von compass. https://www.compass-pflegeberatung.de/fileadmin/Berichte/Forsa-Depression_20161020.pdf (Letzter Zugriff: 19.3.2018)
DGB (2017) (Hrsg): DGB-Index Gute Arbeit. Der Report 2017. Wie die Beschäftigten die Arbeitsbedingungen in Deutschland beurteilen. Mit den Themenschwerpunkt: Arbeit, Familie, private Interessen – wodurch die Vereinbarkeit behindert wird und wie sie zu fördern ist. Berlin: Institut DGB-Index Gute Arbeit.
DGB (2018) (Hrsg): Berufstätige mit Pflegeverantwortung. Zur Vereinbarkeit von Arbeit und Pflege. In: DGB-Index Gute Arbeit kompakt. 02/2108. http://www.dgb.de/themen/++co++dde051f8-0a80-11e8-a822-52540088cada. (Letzter Zugriff: 9.4.2018)
Geyer, Johannes; Schulz, Erika (2014) Who cares? Die Bedeutung der informellen Pflege durch Erwerbstätige in Deutschland. In: DIW Berlin – Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V.: DIW Wochenbericht Nr. 14.2014, Berlin.
Gräßel, Elmar; Behrndt, Elisa-Marie (2016): Belastungen und Entlastungsangebote für pflegende Angehörige. In: Jacobs, Klaus u.a. (Hrsg.): Pflege-Report 2016 Schwerpunkt: die Pflegenden im Fokus. Stuttgart: Schattauer‚ S. 169-187.
Hielscher, Volker u.a. (2017): Pflege in den eigenen vier Wänden: Zeitaufwand und Kosten. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung.
Hobler, Dietmar u.a. (Hrsg.) (2017): Wer leistet unbezahlte Arbeit? Hausarbeit, Kindererziehung und Pflege im Geschlechtervergleich. Aktuelle Auswertungen aus dem WSI GenderDatenPortal. In: WSI (Wirtschaft- und Sozialwissenschaftliches Institut): Report Nr.35.
Leiber, Simone; Schultz, Laura (2018): Wenn Beschäftigte Angehörige pflegen: Anforderungen an die betriebliche Sozialpolitik. In: Soziale Sicherheit 2/2018.
Löhe, Julian (2017): Angehörigenpflege neben dem Beruf. Mixed Methods Studie zu Herausforderungen und betrieblichen Lösungsansätzen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Schwinger, Antje; Tsiasioti, Chrysanthi; Klauber, Jürgen (2016): Unterstützung in der informellen Pflege – eine Befragung pflegender Angehöriger. In: Jacobs, Klaus u.a. (Hrsg.): Pflege-Report 2016 Schwerpunkt: die Pflegenden im Fokus, Stuttgart: Schattauer‚ S. 189-216 .
Suhr, Ralf; Naumann, Dörte (2016): Vereinbarkeit von Beruf und Pflege – Rahmenbedingungen und Bedarfslagen. In: Jacobs, Klaus u.a. (Hrsg.) (2016): Pflege-Report 2016 Schwerpunkt: die Pflegenden im Fokus. Stuttgart: Schattauer‚ S. 217-228.
Wetzstein, Matthias; Rommel, Alexander; Lange, Cornelia (2015): Pflegende Angehörige – Deutschlands größter Pflegedienst. In: GBE kompakt 3, S. 1-10 .
Zentrum für Qualität in der Pflege (Hrsg.) (2016): ZQP-Themenreport. Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Berlin: Zentrum für Qualität der Pflege.
[1] https://www.gesetze-im-internet.de/sgb11/14.html. Letzter Zugriff: 19.3.2018.
[2] Wetzstein (2015), S. 3; Geyer (2014) S. 295.
[3] Siehe hierzu Beitrag in diesem Journal: Querverweis mit Link.
[4](Wetzstein (2015), S. 3 und Schwinger (2016), S. 189.
[5] Hielscher (2017), S. 99f.
[6] ZQP (2016), S. 65 und 73.
[7] Geyer (2014), S. 297ff.
[8] Hielscher (2017), S. 92f.
[9] Geyer (2014), S. 298f.
[10] Schwinger (2016), S. 193ff und Holber (2017), S. 23.
[11] Auth (2015), S. 11f.
[12] DGB (2017), S. 13, DGB (2018), S. 1.
[13] Hielscher (2017), S. 10 und im Folgenden S. 99.
[14] Schwinger (2016), S. 196 und ZQP (2016), S. 28f.
[15] DGB (2017), S. 13f, DGB (2018), S. 2.
[16] Wetzstein (2015), S. 3 und ZQP (2016), S. 73.
[17] Gräßel (2016), S. 225. DGB (2018), S. 3.
[18] Geyer (2014), S. 300.
[19] Wetzstein (2015), S. 2; Gräßel (2016), S. 177 und Bestmann (2014) S. 15 f. ZQP (2016) S. 61.
[20] ZQP (2016) S. 73.
[21] Suhr (2016), S. 221 und Leiber (2018).
[22] Schwinger (2016), S. 199.
[23] Hielscher (2017), S. 92f, zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Auth (2015), S. 7.
[24] Löhe (2017), S. 312 sowie Auth (2015), S. 94, 101 und Schwinger (2016), S. 210. Auch Leiber (2018) unterstreichen in der jüngsten Studie zum Thema vor allem die bisherigen Empfehlungen.
[25] Auth (2015), S.12, 21ff., Löhne (2017), 316ff. und Wetzstein (2015), S. 9ff.