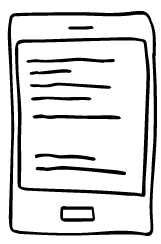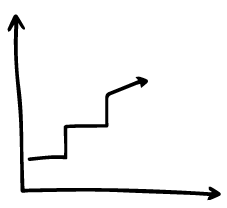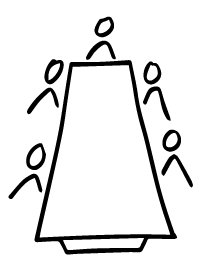Beschäftigte, die sich um demenziell erkrankte Angehörige kümmern, brauchen besondere betriebliche Unterstützung. Foto: pixabay.com.
Brauchen Beschäftigte, die Angehörige mit Demenz pflegen, besondere Unterstützung? Und wenn ja, welche? Nehmen Betriebe die Herausforderungen der Pflege eines Demenzkranken wahr? Mit welchen Maßnahmen entlasten sie dabei die Beschäftigten? Diesen Fragen widmet sich ein interdisziplinäres Praxisentwicklungsprojekt im Masterstudiengang „Multiprofessionelle Versorgung von Menschen mit Demenz“, den die Universität Witten/Herdecke anbietet. Das Projekt fokussiert auf Erfahrungen, die Beschäftigte selbst machen, sowie auf Einblicke aus der Beratungspraxis. Mirja Bialke führte mit Dr. Elisabeth Mantl ein Expertinneninterview, welches wir hier gekürzt wiedergeben.
Frage: Welche Rolle nimmt das Thema Demenz in den Betrieben ein, die sie beraten, und finden Beschäftigte mit demenziell erkrankten Angehörigen besondere Berücksichtigung?
MANTL: Der Druck wächst spürbar, sich als Arbeitgeber*in auch im Thema Demenz aufzustellen. Durch die demografischen Entwicklungen steigt der Altersdurchschnitt in den Betrieben. Immer mehr Menschen müssen neben der Arbeit auch für Angehörige mit Demenz sorgen. Zudem gehört in vielen Betrieben der Großteil der Beschäftigten der Babyboomer-Generation an, deren Eltern in der Regel in einem Alter sind, das mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Pflegebedürftigkeit einhergeht. Zusätzlich wird in den Betrieben der Anstieg des Rentenalters sichtbar und spürbar. Während noch vor neun Jahren die Möglichkeit bestand, mit Blockmodellen frühzeitig in Rente zu gehen, ist das heute nicht mehr möglich. In der Konsequenz gibt es heute faktisch immer mehr Beschäftigte, die sich um zu pflegende Angehörige kümmern und Erwerbstätigkeit mit einer Pflege vereinbaren müssen. Deshalb hat die Auseinandersetzung mit dem Thema vielerorts bereits begonnen. Unterstützungsangebote sind aber meist noch nicht voll ausgereift, und vieles muss sich noch zurechtruckeln. Außerdem sind die besonderen Begleitumstände einer Demenzpflege noch nicht ausreichend thematisiert. Einige der Unternehmen und Hochschulen, die ich begleite, bieten bereits Informationsveranstaltungen und Beratung an, die auch auf die besonderen Herausforderungen bei der Pflege demenziell Erkrankter eingehen. Typischerweise wird die Angehörigenpflege aber eher im größeren Rahmen ohne den Fokus auf Demenz behandelt.
Beschäftigen sich die Betriebe je nach Branche oder Größe unterschiedlich mit dem Thema? Wenn ja, inwiefern?
MANTL: Die Auseinandersetzung mit Fragen rund um die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege oder Demenz beginnt unabhängig von der Branche und der Zahl der Beschäftigten. Meiner Beobachtung nach gibt es keine Unterschiede, ob es sich um ein Unternehmen des öffentlichen Dienstes oder der freien Wirtschaft handelt. Entscheidend ist die Altersstruktur der Betriebe. Je höher der Altersdurchschnitt, umso bedeutender wird das Thema für den Arbeitgeber.
Inwiefern beobachten Sie die betriebliche Notwendigkeit, speziell auf die Herausforderungen bei der Pflege von Menschen mit Demenz einzugehen? Womit müssen sich Arbeitgeber*innen mehr als bislang auseinandersetzen?
MANTL: Hier gibt es drei wesentliche Aspekte: Langfristigkeit der Pflege, Burnout-Gefahr und hohe Anforderungen an die zeitfliche Flexiblität. Da Demenz immer einen viele Jahre andauernden, sich progressiv verschlechternden, unumkehrbaren Verlauf nimmt, zieht jede Demenz einen langfristigen Pflegebedarf nach sich. Pflegende wie Arbeitgebende müssen sich deshalb auf langfristige Vereinbarkeitsmodelle einstellen und verständigen. Aktuell, so meine Beobachtung, sind die Unterstützungsangebote noch eher kurzfristiger Natur. Wie Arbeitgeber*innen mit einer über viele Jahre dauernden Pflegeanforderung an die Beschäftigten umgehen können, ist noch offen. Die langsfristige Doppelbelastung aus Beruf und Demenzpflege müsste noch stärker in den Fokus rücken. Hinzu kommen die für eine Demenz typischen Verhaltensauffälligkeiten, welche die pflegenden Beschäftigten besonders herausfordern und stark belasten können. Dazu zählen insbesondere der veränderte Tag-Nacht-Rhythmus, die oft reduzierte Affektkontrolle, Aggression und Trauer, der Verlust an kommunikativen, sozialen und Alltagskompetenzen. Anforderungen und Abläufe in der Versorgung und Begleitung sind oft unvorhersehbar. Beschäftigte, die sich um demenziell Erkrankte kümmern, stehen vor hohen emotionalen und physischen Belastungen und sind zusätzlich hinsichtlich der benötigen zeitlichen Flexibilität besonders herausgefordert.
Es gibt also eine große Notwendigkeit für Betriebe, auf diese speziellen Pflegebelastungen einzugehen. Welche betrieblichen Maßnahmen erachten Sie als sinnvoll und hilfreich?
MANTL: An erster Stelle sehe ich Wissen und Verständnis. Meines Erachtens ist es unerlässlich, dass Führungskräfte gut informiert sind und eine Vorstellung davon haben, wie Demenz verläuft. Sie müssen wissen, welche Verhaltensauffälligkeiten auftreten können und welche Belastungen Beschäftigte, die demenziell Erkrankte pflegen, zu bewältigen haben. Führungskräfte benötigen Wissen, um angemessen zu reagieren und zu unterstützen. Sie sollten frühzeitig intervenieren können, wenn sie erste Burnout-Symptome wahrnehmen. Noch ist das Wissen meiner Beobachtung nach oft erfahrungsgebunden. Führungskräfte, die selbst eine an Demenz erkrankte Person in der Familie haben, sind sich der Anforderungen sehr bewusst. Sie bringen dieses Erfahrungswissen mit in die Organisation und agieren entsprechend. Häufig äußern sich Beschäftigte dahingehend, dass ihre Führungskraft selbst Erfahrungen im Umgang mit Demenz gemacht hat und deshalb sehr verständnisvoll unterstützt. Es wäre ein erster wichtiger Schritt, in den Organisationen Standardwissen jenseits des Erfahrungswissens aufzubauen. Dies könnte zum Beispiel im Rahmen von Sensibilisierungstrainings oder Schulungen passieren.
Das ist interessant. In der Forschungsliteratur wird oft beschrieben, dass Beschäftigte nicht über ihre häusliche Pflegesituation kommunizieren. Deshalb bestünde in erster Linie die Notwendigkeit, Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege überhaupt erst aus der Tabuisierung herauszuholen. Sie deuten jedoch an, dass Beschäftigte durchaus über ihre Vereinbarkeitssituation sprechen. Liegt das daran, dass Betriebe, die sie beraten, Vereinbarkeit bereits gut kommunizieren?
MANTL: Meiner Beobachtung nach sprechen Betriebe, die in Sachen eines familienbewussten Personalmanagements gut aufgestellt sind, immer selbstverständlicher auch Beschäftigte mit Pflege an. Für diese Betriebe kann ich die These, wonach Pflegeanforderungen in der Familie noch stark tabuisiert sind, nicht oder nur bedingt bestätigen. Oft werden in familienbewusst aufgestellten Unternehmen pflegebedingte Vereinbarkeitsbelange auf kurzem Weg und im direkten Dialog zwischen Führungskräften und Beschäftigten geklärt. Meine Erfahrung ist, dass der Großteil der Führungskräfte sehr wohl weiß, wie viele in ihrem Team mit dem Thema Pflege befasst sind, um wen sie sich kümmern und wie die Pflegeanforderungen sind. Bietet ein Betrieb Gleitzeit an, wenden sich selbstverständlich auch pflegende Beschäftigte mit der Bitte um einen Gleittag an die Führungskraft, etwa um eine Mutter zum Arzt zu begleiten oder einen Behördengang zu erledigen. Ja, ich denke, es ist entscheidend, wie offen Arbeitgeber*innen pflegende Beschäftigte in der Unternehmenskommunikation ansprechen.
Demenzpflegende Beschäftigte brauchen also sowohl kurzfristige Möglichkeiten der Arbeitsflexibilisierung als auch langfristige Entlastungsmodelle. Welche Maßnahmen können pflegende Angehörige in einer phasenweise hohen Beanspruchung tatsächlich entlasten?
MANTL: Überall, wo Möglichkeiten der flexiblen Arbeitszeitzeitgestaltung angeboten werden, entlasten diese auch Beschäftigte mit demenziell erkrankten Angehörigen. Dies gilt zunächst einmal für die Möglichkeit, im Notfall sofort reagieren und die Arbeit unterbrechen zu können, wenn eine angehörige Person mit Weglauf- oder Bewegungstendenz an der Kasse steht und nicht bezahlen kann oder aufgelesen worden ist. Entlastend sind natürlich auch alle Gleitzeitregelungen, die es den Beschäftigten erlauben, Arbeitsbeginn und -ende zu flexibilisieren und auf Unvorhersehbares zu reagieren, ohne gegen Arbeitszeiten zu verstoßen oder ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.
Hilfreich sind des Weiteren alle Formen des ortsunabhängigen Arbeitens, mittels derer Beschäftigte Wegzeiten einsparen oder ihre Arbeitsrhythmen abändern können. Beschäftigte sind oft froh, wenn sie nicht ins Büro müssen, sondern nach dem Arztbesuch von zu Hause aus arbeiten können. Das funktioniert oft gut. Weil viele Unternehmen es inzwischen als Führungsaufgabe ansehen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen, wird dieser Umgang mit dem Thema zunehmend selbstverständlich. Beim Arbeitsort muss man natürlich vorsichtig sein, arbeiten soll man definitiv außerhalb der Pflegesituation. Die Parallelität erhöht den Stresslevel, statt ihn zu reduzieren. Da müssen Arbeitgeber*innen ein gutes Auge drauf haben. Insgesamt aber sind Angebote der flexiblen Arbeitszeit- und Arbeitsortgestaltung gute und wichtige Möglichkeiten, um Beschäftigte mit demenziell erkrankten Angehörige in der Alltags- und Notfallbewältigung zu unterstützen.
Herausfordernder ist der Umgang mit der Langfristigkeit der Stressbelastung und dem Burnout-Risiko. Hier läge es nahe, die Arbeitszeit zu reduzieren, wenn die Pflegeanforderungen steigen. Oft wählen Beschäftigte diese Möglichkeit jedoch ab, weil sie mit finanziellen Einbußen einhergeht, die sie nicht kompensieren können. Dann bleiben die Pflegenden in Vollzeit und folglich auch in der Stressbelastung. Nachvollziehbar können Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten sinken. Hier aktiv zu werden, ist für die Arbeitgeber in mehrerlei Hinsicht eine komplexe Anforderung.
Hierfür sollte es demnach andere Möglichkeiten geben, diejenigen trotzdem zu entlasten. Sonst hat man am Ende Mitarbeitende, die zwar weiter zur Arbeit kommen, aber in ihren Leistungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Inwiefern beobachten Sie diesbezügliche Anpassungen?
MANTL: In der Tat wären meiner Beobachtung nach mittelfristige Anpassungen in der Arbeitsorganisation und dem Aufgabenzuschnitt nötig. Maßnahmen, die von Übergangszeiten oder Ausnahmen ausgehen, die sich in absehbarer Zeit wieder entspannen, reichen in der Regel eben leider nicht aus. Sie lassen das latente Burnout-Risiko außer Acht. Die mit der Demenzpflege verbundene Langfristigkeit erfordert strukturelle Lösungen, die sowohl die pflegenden Beschäftigten entlasten, als auch die Teams nicht durch Mehrarbeit überlasten und die Erfüllung der Dienstaufgaben sichern. Hierzu zählen Teilzeitmodelle, bei denen die Vertretung der freigesetzten Stellenanteile gewährleistet ist, oder das Abpuffern von Leistungseinbußen durch personelle Verstärkung, wenn Teilzeit auf Grund der finanziellen Belastungen nicht möglich ist.
Früher wurden sogenannte Schonarbeitsplätze angeboten. Solche Modelle müssen neu gedacht werden, mit dem Ziel, die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit mittelfristig zu erhalten. Dies aber bräuchte mehr personelle und finanzielle Puffer, und die werden, soweit ich das beobachte, im Moment kleiner statt größer. Klar spielen auch Maßnahmen im Bereich Gesundheitsförderung und Burnout-Prävention eine wichtige Rolle. Es können dann zum Beispiel auch Resilienzangebote und Kurse zum Stress-und Selbstmanagement für pflegende Beschäftigte entwickelt werden, möglichst vor Ort und während der Arbeitszeit. Eigentlich aber bräuchte es mehr materielle Kompensation der Angehörigenpflege von staatlicher Seite. Meines Erachtens reichen die gesetzlichen Leistungen nicht aus, bleibt zu viel bei den Arbeitgeber*innen und den Beschäftigten hängen.
Sie haben bereits die Bedeutung des Führungshandelns und der Kommunikationskultur angesprochen. Welche Maßnahmen helfen, die Tabuisierung des Themas im Betrieb zu überwinden und eine Vertrauenskultur zu schaffen?
MANTL: Wichtig ist eine betriebsweite Kommunikation und Aufklärung, um ein Unternehmensklima zu schaffen, das es pflegenden Beschäftigten erleichtert, sich mit ihren Anliegen und Erfahrungen an die Kolleg*innen und Führungskräfte zu wenden. Gut angenommen und geschätzt werden zum Beispiel themeneinschlägige Vorträge, die sich an die gesamte Belegschaft richten. Des Weiteren wirkt sich positiv auf das Unternehmensklima aus, wenn Führungskräfte Fragen der Vereinbarkeit immer wieder proaktiv ansprechen und auf die Bereitschaft des Betriebs verweisen, Beschäftigte zu unterstützen, die sich um demenziell erkrankte Angehörige kümmern. So einen Hinweis kann man als Führungskraft zum Beispiel im Mitarbeitergespräch fallenlassen.
Sehr hilfreich sind darüber hinaus anonyme Beratungsangebote, entweder durch sozialärztliche Dienste oder in Kooperation mit externen Dienstleister*innen. Mit diesen können die Pflegenden auf einer viel persönlicheren und auch tieferen Ebene reden, sich emotionale Unterstützung oder Ratschläge holen. In diesem Kontext ist es für die Führungskräfte wichtig, zu wissen, wo ihre Fürsorgeverantwortung als Führungskraft endet. Dies gilt umso mehr, als viele Beschäftigte erst das Gespräch suchen, wenn die Überforderung schon sehr groß ist. Und da die Führungskraft ja keine Sozialberatung ist, ist es entlastend, auf eine professionelle Beratung verweisen zu können.
Das Interiew führte Mirja Bialke.