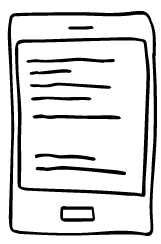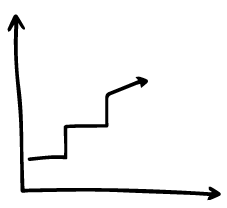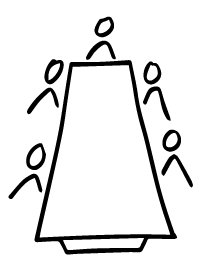Radfahrer*innen absteigen: Aufkleber an einem Hinweisschild in Kiel (Coyote III /wikimedia)
-> Artikel als pdf-Dokument downloaden
Kritik an der Maskulinität der deutschen Sprache wurde im großen Stil erstmals in den 70er Jahren formuliert. Die Debatte um die Geschlechtergerechtigkeit von Sprache ging einher mit neuen sprachphilosophischen Strömungen und einer feministisch geprägten Anfrage wissenschaftlicher Diskurse.[1]
1. Die Anfänge: Männersprache und unsichtbare Frauen
In den 70er Jahren wandten sich Sprachphilosph_innen erstmals in großem Umfang der Logik von Personen- und Berufsbezeichnungen und Pronomina sowie den Verfahren der Wortbildung zu. Sie begründeten damit die Forschungsrichtung der sogenannten Philosophie der normalen Sprache. Vertreterinnen der Geschlechterforschung adaptierten die diesbezügliche Theorien und Erkenntnisse und begannen das Wechselspiel von Syntax, Sprachstruktur und Geschlecht zu erforschen.[2] Wegweisend hierfür waren die Arbeiten von Mary Ritchie Key und Robin Lakoff.
Key und Lakoff bezogen sich vor allem auf Arbeiten des britischen Philosophen John Langshaw Austin, den Begründer der Sprechakttheorie und Vorreiter der Philosophie der normalen Sprache. Austin überwand die bis dahin geltenden Theoreme, wonach sprachliche Bedeutung sich ausschließlich auf Wahrheitsbedingungen beschränkt. In seinem Grundlagenwerk „How to do things with words“ entwickelte er erstmals die These, dass Äußerungen stets auch Handlungen sind, die konkrete interaktionelle Ziele verfolgen und dabei gelingen, misslingen, wahr oder falsch sein können. Er arbeitete erstmals die Wirkmächtigkeit von Diskursen auf die Konstruktion von Wirklichkeit heraus und sensibilisierte für die performative Kraft von Sprache.
Lakoff befasste sich intensiv mit Mustern weiblicher Sprachpraxis und stellte die These auf, dass Frauen in ihrem eigenen Sprachhandeln dazu neigen, ihre Aussagen zu relativieren und abzuschwächen. In „Language and Woman´s Place“ beschrieb sie, dass eine eigene Frauensprache existiere, die sich kategorial von jener von Männern unterscheiden lasse. Lakoff glaubte, hierfür zehn wesentliche Differenzkriterien identifizieren zu können.
So würden Frauen beispielsweise häufiger als Männer Verkleinerungsformen, relativierende Einleitungen, Konjunktivierungen, hyperkorrekte oder sich entschuldigende Formulierungen nutzen. Insgesamt drücke sich in dieser vermeintlich existierenden eigenen Frauensprache die Machtlosigkeit von Frauen aus. Sprachregeln und Sprachpraxis wurden als Abbild patriarchaler Machtverhältnisse gewertet, die Frauen in ihrer untergeordneten Rolle festhalten.[3]
Die Frauen selbst, so die Deutung, rezipierten in ihrer eigenen Sprachnutzung das asymmetrische Geschlechterverhältnis und schrieben gleichzeitig ihre untergeordnete Rolle fort. In dieser eher defizitorientierten Deutung unterstellte besonders Robin Lakoff, dass Sprache Frauen gar keine Möglichkeit biete, kommunikativ ihre geschlechtsbegründete Unterordnung aufzubrechen. Frauen würden so dauerhaft ihren Status der Unterordnung adaptieren. In Weiterführung der Austin´schen Theorie der performativen Kraft von Sprache, ging Lakoff davon aus, dass Worte das, was sie bezeichnen, auch vollziehen. D.h. indem Frauen die männliche Form (sprich das generische Maskulinum) nutzen, relativierend und sich zurücknehmend sprechen, vollziehen und bestätigen sie automatisch ihre patriarchal begründete Unterordnung.[4]
Lakoffs Thesen konnten zwar empirisch nicht weiter belegt werden. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Sprache in ihrer Geschlechterungleichheit abbildenden und generierenden Funktionalität schärfte aber den Blick für die Unterrepräsentanz von Frauen in der Alltagssprache. Zugleich wurde die Forderung laut, die Dominanz des generischen Maskulinums zu überwinden. Frauen sollten sprachlich sichtbar gemacht werden, um ihnen neue Räume der Selbstäußerung und Selbstermächtigung zu eröffnen.
Die einflussreichsten Vertreterinnen dieser Sichtweisen im deutschen Sprachraum waren Luise F. Pusch und Senta Trömel-Plötz. Sie veröffentlichten in den frühen 70er Jahren die ersten „Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs“.
2. Die Theorie vom Doing Gender
Bald schon wurde jedoch Kritik an den Forschungsformaten laut, die sich auf die Analyse einzelner Sprachmerkmale konzentrierten und der Idee der Männer- und Frauensprache („genderlect“) bei Lakoff folgten.[5] Forschungsdesigns aus den 80er Jahren überwanden die Vorstellung einer spezifischen Frauen- bzw. Männersprache und nahmen stattdessen die Differenzen und Ähnlichkeiten im Sprachhandeln von Frauen und Männern in den Blick. Darüber hinaus erschienen Frauen nicht mehr länger als Objekte oder Opfer von Sprache. Vielmehr wurde die aktiv (re)produzierende und verändernde Rolle in den Blick genommen, die Frauen in der Kommunikation und Interaktion sowohl innerhalb des eigenen Geschlechts als auch zwischen den Geschlechtern zukommt.
Während in der Analyse des Sprachgebrauchs die Unsichtbarkeit von Frauen zu großen Teilen ihrem eigenen Gebrauch von Sprache und ihrer sprachlich zementierten Ohnmacht angelastet wurde, identifizierten die Sprachsystemanalytiker_innen die Sprache selbst als eigentliche Ursache für die Benachteiligung und Minderbewertung von Frauen. Damit wurde wissenschaftstheoretisch die Analyse des Sprachgebrauchs in eine Analyse des Sprachsystems überführt.
Systemisches Denken gewann aber nicht nur in der Sprachphilosophie an Bedeutung. Auch in der Soziologie und der Psychologie bestimmten systemtheoretische Überlegungen Theoriebildung und Wissenschaftsdiskurse. Richtungsweisend waren die Arbeiten von Niklas Luhmann, dessen Grundlagenwerk „Soziale Systeme – Grundriss einer allgemeinen Theorie“ 1984 veröffentlich wurde, sowie jener der Heidelberger Schule um Helm Stierlin, deren Mitglieder den systemischen und narrativen Ansatz als Methode der Psychotherapie entscheidend weiterentwickelten.
Luhmann wie Stierlin gingen davon aus, dass Systeme stets danach streben, sich selbst zu erhalten und zu perpetuieren. Veränderung wird zugelassen, wenn sie zum Systemerhalt beiträgt und mithin notwendig erscheint. Um Systeme nachhaltig zu sichern und fortzuschreiben, würden – systemisch gedacht – komplexe Mechanismen von Rückkopplung und Feedback, von Ausschluss und Einbindung wirksam werden. Sprachhandeln einschließlich seiner Interaktionsprozesse galt fortan als entscheidend, um soziale und kommunikative Systeme auszubilden und zu perpetuieren.
Wie schon die Sprachakttheorie hat auch die Systemtheorie die weitere Geschlechterforschung nachhaltig beeinflusst. Candace West und Don H. Zimmermann waren die ersten, die die systemischen Theorien in der Geschlechterforschung anwandten. Aufbauend auf der Idee von Sprache als performative Handlung interpretierten sie Geschlecht folgerichtig als sozial und kulturell konstruiert. Beeinflusst von ihren eigenen ethnomethodologischen Untersuchungen unterschieden die beiden in ihren Arbeiten zwischen der Geburtsklassifikation (Sex), der sozialen Zuordnung des Geschlechts (Sex-Categorie) und der intersubjektiven Validierung von Geschlecht (Gender).[6] Damit galt Geschlecht fortan als soziale Kategorie, die sich u.a. durch Sprachhandeln kontinuierlich produziert und reproduziert.
Die Vorgänge, mittels derer Geschlecht produziert und reproduziert werden, beschrieben West/Zimmermann mit dem Konzept des „doing gender“. Geschlecht (Gender) wird erklärt als ein stetiges ‚Tun‘ eines der Geschlechtskategorie (Sex-Category) adäquaten Verhaltens: „virtually any activity can be assessed as to its womanly or manly nature […]. To ‚do‘ gender […] is to engage in behavior at the risk of gender assessment“.[7] West/Zimmermann gingen weiter davon aus, dass der Prozess des Doing Gender durch eine Vielzahl institutioneller Arrangements und Wissenssysteme abgesichert wird. Diese reichen, so die Theorie, von vagen Handlungserwartungen bis hin zu konkreten Interaktionsskripten. Ein Handeln außerhalb des doing gender ist für West und Zimmerman nicht denkbar.
West/Zimmerman haben später ihr Konzept des Doing Gender zugunsten eines Doing Difference ausgeweitet[8], um auch weitere Kategorien (Rasse, Klasse, Alter) in der Ausbildung sozialer und geschlechtsbezogener Systeme berücksichtigen und erforschen zu können.
Die Trennung zwischen einem sozialen und einem biologischen Geschlecht prägt bis heute die wissenschaftliche Beschäftigung mit Geschlecht. Zur sprachlichen Kennzeichnung des sozialen Geschlechts hat sich in der Forschung und den einschlägigen Diskursen der Begriff Gender eingespielt.
Die Forderung nach Überwindung des generischen Maskulinums ist die Gleiche geblieben wie in den 70er Jahren. Sie wurde lediglich anders begründet. Es ging nun nicht mehr um die sprachliche Selbstunterordnung von Frauen, sondern um das Systemische von Sprechakten und ihre Ungleichheit produzierende und fortschreibende Wirkung, die es zu überwinden galt. Dazu gehörte weiterhin, Frauen sprachlich sichtbar zu machen und den sprachlichen Referenzrahmen eines geschlechter- und ungleichheitsüberwindenden Sprachhandelns auszuweiten.
Die systemischen Ansätze schärften im Folgenden das Bewusstsein um die performative und damit „Wirklichkeit“ stiftende Rolle von Sprache. Sie machten die sprachlich induzierten Assoziationen und die psychosozialen Handlungsmotivationen, die im Vor- und Unterbewussten wirksam werden, erkennbar und haben zu einem deutlich sensibleren Sprachhandeln beigetragen. In dieser Zeit wurden in Deutschland auch die ersten rechtlichen Vorgaben zur Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache verabschiedet.[9] Wenn auch nicht unbedingt allseits geliebt und akzeptiert, hat die Verwendung der männlichen und weiblichen Form, die Nutzung von Nominalisierungen sowie des Binnen-I, des Schrägstrichs oder die in Klammer gesetzte weibliche Form eine gewisse Selbstverständlichkeit erlangt.
3. Wider die Zweigeschlechtlichkeit der Sprache.
Die Theorie vom Undoing Gender
Die 90er Jahre brachten einen weiteren Meilenstein in der Dekonstruktion von Geschlecht als sozialer und biologischer Kategorie. In Tradition von Derrida stehend war es vor allem Judith Butler, die erstmal selbst die biologische Determiniertheit von Geschlecht in Frage stellte. Die Theoreme des „doing gender“ blieben, so die Hauptkritik, dem Konzept von Geschlecht als Zweigeschlechtlichkeit verhaftet, dessen Erkenntnisinteresse und Erklärungsmodell seien selbst wiederum der Idee einer binären Geschlechterordnung verpflichtet.
Butler bestritt, dass das soziale Geschlecht einer vorgesetzten Größe, nämlich dem Sexus, folgt. Sie stellte die binäre Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit grundsätzlich in Frage. Statt in Kategorien der Zweigeschlechtlichkeit zu denken, seien vielmehr Diversität und Relativität von Geschlecht zu betrachten.
In der radikalen Zuspitzung vom „doing gender“ versteht Judith Butler auch die biologische Dimension von Geschlechts als konstruiert. Der Sexus erscheint wie das soziale Geschlecht als Materialisierung von Normen, die regulieren, sich in Kommunikation/Sprachhandlungen wiederholen und selbst bestätigen. In Butlers Konzept gibt es folglich auch keine psycho-sozial erworbenen und feststehenden Geschlechtsidentitäten mehr. Stattdessen werden sie als variabel, veränderbar, modifizierbar verstanden, jeweils neu hervorgebracht durch Interaktion. In der Betonung der autonomen Subjekthaftigkeit löst sich bei Butler Geschlecht als feste Kategorie auf. Der Kategorie Geschlecht stellt sie das mit einem Geschlecht versehene Individuum entgegen.
Mit der Dekonstruktion der Kategorie eines biologisch festgelegten Geschlechts schärfte Butler den Blick für die Relativität von Geschlecht und Zweigeschlechtlichkeit bzw. für Geschlechtsidentitäten jenseits der Zweigeschlechtlichkeit. Etwa gleichzeitig erstarkte ausgehend von den USA auch in Deutschland die Queer-Bewegung, die sich ihrerseits für eine öffentliche Neubewertung und die Anerkennung anderer als männlicher oder weiblicher geschlechtlicher Identitäten stark machte.
Einmal in den Blick genommen, stellt sich automatisch die Frage, wie der Bandbreite geschlechtlicher Identitäten auch sprachlich gerecht werden und eine Diskriminierung durch Nutzung einer zweigeschlechtlichen Sprache verhindert werden kann. Die Dekonstruktion der Zweigeschlechtlichkeit fordert(e) dazu heraus, die Vielfalt und Variabilität von Geschlecht, Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung auch sprachlich abzubilden.
4. Antidiskriminierendes Sprachhandeln
Dies zu tun, hat sich in Deutschland u.a. Lann Hornscheidt auf die Fahnen geschrieben. Lann Hornscheidt lehrt und forscht am Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien zu Genderstudies und Sprachanalyse. Dort sind auch diverse Leitfäden zur Umsetzung eines antidiskriminierenden, die Uneindeutigkeit von Geschlecht und Geschlechtsidentität kennzeichnenden Sprachhandelns entstanden. Die Verwendung des Unterstrichs oder des Sternchens als Alternative zur zweigeschlechtlichen Schreibweise ist nur ein Bespiel.
Wie sehr die dekonstruktivistischen und poststrukturalistischen Erkenntnisse die überlieferte, patriarchale und zweigeschlechtlich ausgerichtete Sprachtraditionen in Frage stellen, zeigen die heftigen Reaktionen in medialen und gesellschaftlichen Diskursen. Lann Hornscheidt hat vor zwei Jahren eine eigene Mailadresse[10] eingerichtet, um sich vor den zahlreichen, übergriffigen und sexistischen verbalen Angriffen zu schützen. Systemisch betrachtet, bestätigen die heftigen Reaktionen die performative Kraft von Sprache und Sprachhandeln für die Fortschreibung überlieferter Systeme und Ordnungen.
Es bleibt abzuwarten, welche neuen Theorien und Erkenntnisse Philosophie, Linguistik, Psychologie in Sachen Gender zu Tage befördern werden, vor allem aber, ob, wie und in welchem Ausmaß all diese Erkenntnisprozesse Eingang in unser tägliches Sprachhandeln finden werden.
[1] Klann-Delius, 2005, S. 7f.
[2] Klann-Delius, 2005, S. 19f.
[3] Zusammenfassend vgl. Lann Hornscheidt 2011, 100ff. und Klann-Delius, 2005, S. 9f.
[4] Lakoff, 1972
[5] Klann-Delius, 2005, S. 11 ff
[6] West/Zimmermann 1987, S. 136
[7] ebd.: 136, http://www.gender-glossar.de/de/glossar/item/18-doing-gender
[8] West/Zimmermann 1995
[9] https://www.elisabeth-mantl.de/antidiskriminierendes-sprachhandeln/
[10] hatemailan@hornscheidt.de
5. Übersicht über die Standardwerke
AG FEMINISTISCH SPRACHHANDELN (2015): Was tun? Sprachhandeln – aber wie? W_Ortungen statt Tatenlosigkeit. Anregungen zum Nachschlagen, Schreiben_Sprechen_Gebärden, Argumentieren, Inspirieren, Ausprobieren, Nachdenken, Umsetzen, Lesen_Zuhören, antidiskrimienierenden Sprachhandeln, Berlin.
AUSTIN, John Langshaw (1986): Zur Theorie der Sprechakte (How to do things with Words). Deutsche Bearbeitung von Eike von Savigny, Stuttgart: Reclam.
BUTLER, Judith (2016): Haß spricht. Zur Politik des Performativen. Berlin: Suhrkamp Verlag, 5. Aufl.
ECKERT, Penelope / MCCONNELL-GINET, Sally (2013): Language and Gender, Cambridge: Cambridge University Press, 2. Aufl.
GILDEMEISTER, Regine / WETTERER, Angelika (1992): Wie Geschlechter gemacht werden. Die soziale Konstruktion der Zwei-Geschlechtlichkeit und ihre Reifizierung in der Frauenforschung In: Knapp, G-A [Hg.]: Traditionen Brüche: Entwicklungen feministischer Theorie. Forum Frauenforschung, Freiburg / Breisgau: Kore Verlag, S. 201-254.
GILDEMEISTER, Regine (2004): Doing Gender: Soziale Praktiken der Geschlechterunterscheidung In: Becker, Ruth/ Kortendiek, Beate [Hg.]: Handbuch der Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 132-141.
GOFFMAN, Erving (2001 [1977]): Das Arrangement der Geschlechter, in: Knoblauch, H. [Hg.]: Interaktion und Geschlecht, Frankfurt a.M./ New York: Campus, S. 105-158.
HIRSCHAUER, Stefan (1996): Die soziale Fortpflanzung der Zwei-Geschlechtlichkeit, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 46, S. 668-692.
HIRSCHAUER, Stefan (2001): Das Vergessen des Geschlechts. Zur Praxeologie einer Kategorie sozialer Ordnung. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 41, S. 208-235.
HORNSCHEIDT; Lann (2012): feministische w-orte. Ein lern-, denk- und handlungsbuch zu sprache und diskriminierung, gender studies und feministischer linguistik, Frankfurt am Main: Brandes & Apsel.
KESSLER, Suzanne J. / MCKENNA, Wendy (1978): Gender. An ethnomethodological approach, New York: Wiley.
KEY, Mary Ritchie (1975): Male/female language. With a comprehensive bibliography, Metuchen, N.J.: The Scarecrow Press.
KLANN-DELIUS, Gisela (2005): Sprache und Geschlecht: Eine Einführung, Stuttgart: J.B. Metzler.
LAKOFF, Robin, hg. von Mary Bucholtz,(2004 [1972]): Language and Women’s Place. Text and Commentaries, Oxford: Oxford University Press, NY.
LUHMANN, Niklas (1984): Soziale Syteme, Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
PUSCH, Luise (1984): Das Deutsche als Männersprache. Aufsätze und Glossen zur feministischen Linguistik, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
STIERLIN, Helm (1994): Ich und die anderen. Psychotherapie in einer sich wandelnden Gesellschaft, Stuttgart: Klett-Cotta.
TRÖMEL-PLÖTZ, Senta (2008): Sprache: Von Frauensprache zu frauengerechter Sprache. In: Becker, Ruth/ Kortendiek, Beate [Hg.]: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 756 – 759.
WEST, Candace / ZIMMERMAN, Don H. (1987): Doing Gender, In: Gender & Society 1, S. 125-151.
WEST, Candace / ZIMMERMAN, Don H. (1995): Doing Difference, In: Gender & Society 9, S. 8-37.
-> Artikel als pdf-Dokument downloaden